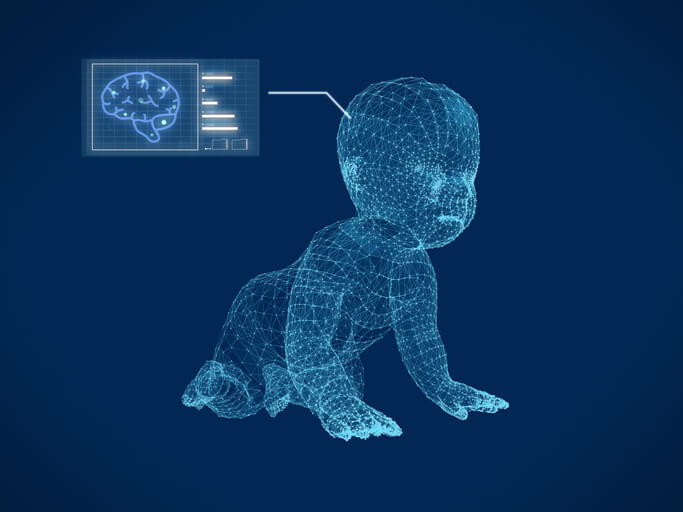
Umsetzung des elektronischen Eltern-Kind-Passes auf 1. Oktober 2026 verschoben
FPÖ hält Kritik aufrecht und pocht weiterhin auf das Recht auf Wahlfreiheit
Die ursprünglich für Anfang 2026 geplante Ablöse des “gelben Papierheftes” durch den elektronischen Eltern-Kind-Pass verzögert sich und wird auf den 1. Oktober 2026 verschoben. Grund dafür sei die “Komplexität des Projekts”, heißt es in den Erläuterungen des Gesetzesentwurfs der Regierungsfraktionen, der heute im Nationalrat mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ, NEOS und Grünen angenommen wurde. Wie schon im Ausschuss brachten die Freiheitlichen eine Reihe von Kritikpunkten vor und plädierten vor allem für ein Recht auf Wahlfreiheit.
Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig sprach von der Weiterentwicklung eines Erfolgsmodells, das durch die Etablierung von digitalen Schnittstellen beispielsweise die Vernetzung mit weiterführenden Unterstützungsangeboten wie etwa den “Frühen Hilfen” erleichtern werde. Sie versicherte, dass bei der technischen Umsetzung des elektronischen Eltern-Kind-Passes die höchsten Datenschutzstandards beachtet werden und dass der Schutz der Privatsphäre gewährleistet sei.
Technische Umsetzung und Aktualisierung des Untersuchungsprogramms
Grundsätzlich soll der Eltern-Kind-Pass (EKP), der bis Ende 2023 als Mutter-Kind-Pass bezeichnet wurde, die Früherkennung von gesundheitlichen und psychosozialen Risikofaktoren von Müttern und deren Kindern ermöglichen. Die nun von der Regierung vorgelegte Novelle sieht vor, dass ab dem 1. Oktober 2026 alle neu festgestellten Schwangerschaften ausschließlich in elektronischer Form dokumentiert werden. Außerdem sollen erstmals ab 1. März 2027 die Daten zu den Kindern, die ab diesem Tag geboren werden, elektronisch gespeichert werden.
Das seit 2014 unveränderte Untersuchungsprogramm, das laut Regierungsvorlage jährlich rund 425.000 Kinder sowie 82.000 Schwangere und Neugeborene erfasst, soll weiterentwickelt und unter anderem durch eine zusätzliche Hebammenberatung vor der Geburt ergänzt werden, durch einen zusätzlichen Ultraschall gegen Ende der Schwangerschaft, weitere Laborleistungen sowie durch ein Gesundheitsgespräch, wie der Vorlage zu entnehmen ist. Bei Letzterem soll der Schwerpunkt auf der Erhebung von psychosozialen und sozioökonomischen Belastungen liegen. Der genaue Umfang, die Art und der Zeitpunkt der Untersuchungen und Gespräche sollen aber erst mittels Verordnung festgelegt werden.
FPÖ ortet eine Reihe von Verschlechterungen und pocht auf Recht auf Wahlfreiheit
Ebenso wie im Gesundheitsausschuss konnte die freiheitliche Fraktion dem Vorhaben wenig abgewinnen. Schon die Umbenennung des Mutter-Kind-Passes “aus schrägen und ideologischen Gründen” sei aus Sicht von Peter Wurm (FPÖ) abzulehnen. Wenn in Hinkunft nur mehr die digitale Variante zur Verfügung stehen werde, dann werde das – auch früher von der SPÖ geforderte – Recht auf analoges Leben “mit den Füßen getreten”. Außerdem seien von vielen Seiten datenschutzrechtliche Bedenken geäußert worden. Wie Dagmar Belakowitsch (FPÖ) beklagte er, dass bei der Geburt eines Babys nicht nur männlich oder weiblich, sondern auch inter, divers, offen oder keine Angabe angekreuzt werden können. In der Biologie gebe es aber nur zwei Geschlechtschromosomen, unterstrich auch Ricarda Berger (FPÖ). Vernunft und Realitätssinn müssten endlich wieder Platz in der Politik finden.
Christoph Steiner (FPÖ) betonte noch einmal, dass es den Freiheitlichen vor allem um die Wahlfreiheit gehe. Viele Eltern und vor allem Mütter hätten eine emotionale Bindung zum gelben Mutter-Kind-Pass. Erbost zeigte er sich auch darüber, dass schon bei der Geburt andere Zuschreibungen als männlich oder weiblich möglich sein werden. Dies sei aus wissenschaftlicher Sicht in der Regel gar nicht möglich. Für Irene Eisenhut (FPÖ) stand vor allem die Frage im Mittelpunkt, ob man seine persönlichen Gesundheitsdaten digitalisieren wolle oder nicht. Dies sei ein Grundrecht, das man schützen müsse.



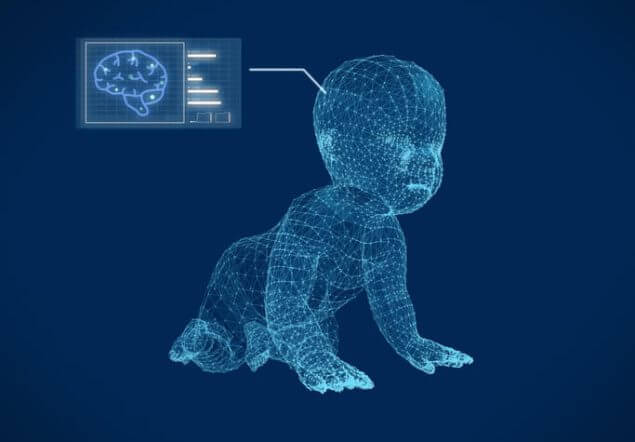
Kommentare