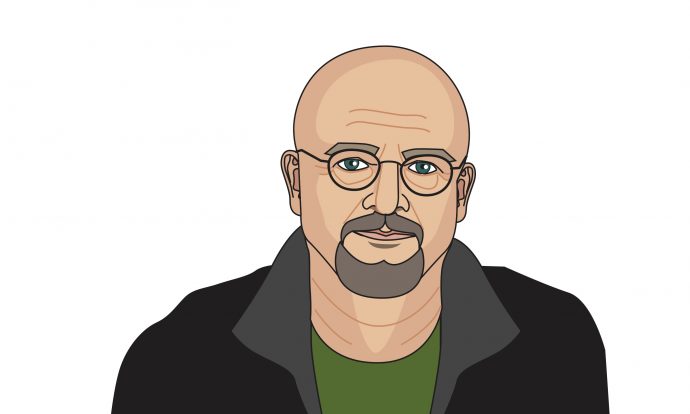
Bernhard Heinzlmaier: Nieder mit der Leitkultur – aber warum eigentlich?
Die Politik ist in Österreich zum Stillstand gekommen, zumindest das, was man früher unter Politik verstanden hat, das engagierte Eintreten für die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung. Geworden ist daraus ein Kammerspiel, das sich meistens in irgendwelchen Prunkräumen des parlamentarischen Historiengebäudes abspielt und in dem es in erster Linie um die Interessen von Parteien geht und nicht um das, was der Durchschnittsbürger will.
Im Augenblick wird gerade eine Geheimdienstposse gegeben, in deren Mittelpunkt ein gewisser Egisto Ott steht. Allein der der Normalität enthobene Vorname des handlungsleitenden Protagonisten zeigt den gepeinigten autochthonen Bewohnern des 10. Bezirks, dass es hier um alles, nur nicht um ihre Probleme geht. Favoriten ist nämlich längst zu einer No-Go-Area Pariser Typs geworden, die man als Österreicher, wenn man es sich leisten kann, am besten verlässt, will man nicht seinen Sohn bei einer Messerstecherei verlieren oder die Tochter als Opfer einer Gruppenvergewaltigung enden sehen. Im ehemaligen Arbeiterbezirk geht es drunter und drüber, aber die SPÖ, früher einmal eine Arbeiterpartei, bevor sie ihre Zielgruppe an die FPÖ freiwillig abgetreten hat, schweigt dazu. Warum ist klar, die Partei profitiert bei Wahlen von den Muslimen und will es sich mit ihnen nicht verscherzen. Überhaupt ist es besser, nicht über das misslungene Migrationsexperiment der Roten und Grünen zu sprechen, denn beim kleinsten kritischen Wort ist man, so schnell kann man gar nicht schauen, als Nazi einsortiert. Und als Nazi lässt es sich schlecht leben in der Stadt der Gerechten, neuestens schneidet einem dann nicht einmal ein durchschnittlicher Friseur die Haare und in einen der dreihundert Barbershops in der Stadt braucht man gar nicht zu gehen, denn dort wird einem schon durch den symbolisch ausgedrückten „Way of Life“ signalisiert, dass man hier nicht erwünscht ist.
Die Politik beschäftigt sich Tag aus Tag ein mit dem gegenseitigen Anpatzen
Aber anstatt dieses für jeden nicht völlig sinnenbetäubten Bürger offensichtliche Problem proaktiv anzugehen, beschäftigt sich die Politik Tag aus Tag ein mit dem gegenseitigen Anpatzen. Sebastian Kurz wollte das ja beenden, anstelle dessen wurde seine politische Existenz beendet, von einem Verbund aus linken Schmutzkübelakrobaten, von denen einer, wie könnte es anders sein, auch unter den Hauptbeteiligten der kleinkriminellen Spionage-Affaire, die die Gazetten dominiert, zu finden ist. Das Schlimmste, was man heute getan haben kann, ist, einmal in seinem Leben mit einem Russen gesprochen oder gar mit einem solchem Geschäfte gemacht zu haben. Dann wird man vehement mit Aliasnahmen wie „Russen-Gert“ oder „Russen-Richi“ belegt, dass man glauben könnte, man sei gerade in einer russophoben präfaschistischen Kleinbürgerdiktatur aufgewacht. Auch räumliche Nähe zu Russen oder Russenspionen ist nicht gut, auch wenn man vielleicht gar nicht gewusst hat, dass einer in der Nähe war. „Marsalek zweimal im Kickl-Ministerium gewesen“, verkündet einer der infamen Parteisoldaten des „SPÖ-FPÖ-Untersuchungsausschusses“, der keinem anderen Zweck als der Verunglimpfung des politischen Gegners dient. Obwohl kein normaler Mensch einen Minister dafür verantwortlich machen würde, wenn jemand die riesige Tintenburg betritt, in der er sitzt, hat die völlig miserable Aktion ihren Zweck erfüllt. Herbert Kickl wurde in einem Atemzug mit dem Russenspion genannt. Zack, das hat gesessen und bleibt picken. So geht Politik für Blöde. Politik für Blöde, das ist das Stichwort. Sie wird immer dann gemacht, wenn den politischen Parteien die Kompetenz fehlt, Politik im Bürgerinteresse zu machen, wenn sie dazu unfähig sind, die horrende Inflation zu bekämpfen, das Gesundheitssystem aufrecht zu erhalten, die Zuwanderer-Kriminalität zu reduzieren und überhaupt den Zustrom an kulturfremden illegalen Flüchtlingen zu begrenzen. Letztere verdreifachen sich spätestens nach einem Jahr ihres Aufenthaltes, weil sie die ganze Großfamilie im Zuge der Familienzusammenführung nachholen. Aber wir haben ja Platz und Geld genug und das Bildungswesen kann ja, man sieht es gerade, die paar Hundert Kinder, die monatlich nach Wien einströmen und kein Wort Deutsch sprechen, recht locker verkraften. Am Ende werden dann alle Schulabsolventen ein holpriges Deutsch sprechen, aber dafür ist das Land dann bunter geworden und darum geht es ja, um den Kampf gegen die monochrome Eintönigkeit. Aus der völlig sachfremden und nur mehr intriganten Tagespolitik hebt sich die Idee, einen Katalog der österreichischen Leitkultur zu erstellen, wie ein Leuchtturm der Hoffnung hervor. Der Bundesministerin Susanne Raab ist es wohl aufgefallen, dass sich die Wiener Straßenzüge symbolisch immer mehr verfremden. Die Bürger fühlen sich fremd im eigenen Land, wenn der Blick nichts mehr Gewohntes im Straßenbild findet, an dem er sich festhalten und Heimatgefühle empfinden kann. Im Sturm fremder Zeichen fühlen sich viele Menschen verloren und entwurzelt. Gefühle der Unsicherheit und Orientierungslosigkeit sind die Folge.
Was ist denn nun so schlecht an der Entwicklung einer österreichischen Leitkultur?
Aber die Ministerin wird ob ihres Ansinnens mit Dreck beworfen. Der linksradikale und antiösterreichische VSStÖ sondert fäkale Beschimpfungen ab. Zu mehr reicht es dort offenbar nicht mehr, eventuell hüstelt man noch Schlagworte wie „transfeindlich“, „rassistisch“ oder „faschistisch“ aus, dann ist die Verbalkreativität aber auch schon an ihr Ende gelangt. Was ist denn nun so schlecht an der Entwicklung einer österreichischen Leitkultur? Der Begriff geht auf Bassam Tibi zurück. Der Islamwissenschaftler hat mit ihm das Bemühen zu bezeichnen versucht, einen „Regelkonsens“ als Basis für ein gelingendes Zusammenleben von Kulturen in einer bunten Gesellschaft zu entwickeln. In kulturwissenschaftlichen Worten gesagt geht es darum, alles das zu katalogisieren, was uns aus unserer empirischen Wirklichkeit als „wertvoll“ erscheint und unserem Leben Orientierung gibt. Gerade in der Postmoderne, die die Pluralisierung von Symbolen und Wertideen kennzeichnet, ist es besonders wichtig, einen übergeordneten kulturellen Rahmen zu finden, der für alle akzeptabel ist und eine gruppenübergreifende gemeinsame Kultur absteckt. Und hier geht es nicht um Menschenrechte, sondern um mehr, es geht um das historische Erbe, Werte, Sitten, Lebensweisen und auch um symbolische und ästhetische Maßgeblichkeiten. Eine klar definierte Leitkultur ist die Voraussetzung dafür, dass so etwas wie Integration überhaupt gelingen kann, denn wie soll man Menschen in einen kulturell-gesellschaftlichen Systemzusammenhang integrieren, wenn man diesen nicht in seinen Wesenszügen definiert und beschrieben hat? Und wie sollen Menschen, die zu uns kommen, überhaupt wissen, was sie an unserer Lebensweise respektieren müssen, wenn wir ihnen nicht sagen, was uns daran besonders wichtig ist? Warum gibt es gegen ein hochvernünftiges und wohl jeden normalen Menschen einleuchtendes Projekt einen dermaßen aggressiven Widerstand der linken Blockparteien SPÖ, Grüne und Neos?
Umfragen zeigen, dass 80% der Österreicher eine patriotische Gesinnung haben.
Ganz einfach, weil sie schon längst ein eigenes Leitkulturkonzept haben und dieses schon seit Jahren heimlich umsetzen. Im Zentrum dieses Planes steht die Aufgabe eines jeden kulturellen Identitätsanspruches. Mitteleuropäische Kultur soll verschwinden, weil sie eine toxische kolonialistische Herrschaftskultur ist. Klassische Musik weg, weil sie eine Beleidigung der Kultur der Zugewanderten ist, abstrakte Kunst weg, weil sie kulturfremde Menschen verstören könnte, unverhüllte Körper weg, weil sie Muslime in Scham versetzen, religiöse Feste weg, weil sie Andersgläubige irritieren könnten, Blasmusik weg, weil sie provinziell und primitiv ist. Man könnte die Aufzählung schier endlos fortsetzen.
Umfragen zeigen, dass 80% der Österreicher eine patriotische Gesinnung haben. Sie finden das kulturelle Erbe des Landes erhaltenswert. Dem steht eine Minderheit entgegen, die unsere Kultur in einem multi-kulturellen Einheitsbrei auflösen möchte, oder gar, wie die Neos, in einem europäischen Bundesstaat beerdigen will. Eine solche Herangehensweise ist hochgradig defätistisch und ist Kennzeichen des Misstrauens gegen ein eigenes Ideal oder gar das Fehlen desselben, wie Friedrich Nietzsche meint. Grüne, Neos und SPÖ haben Österreich aufgegeben. Sie mögen unsere Kultur nicht und wollen sie loswerden. Wer unser Land liebt, darf sie nicht wählen.




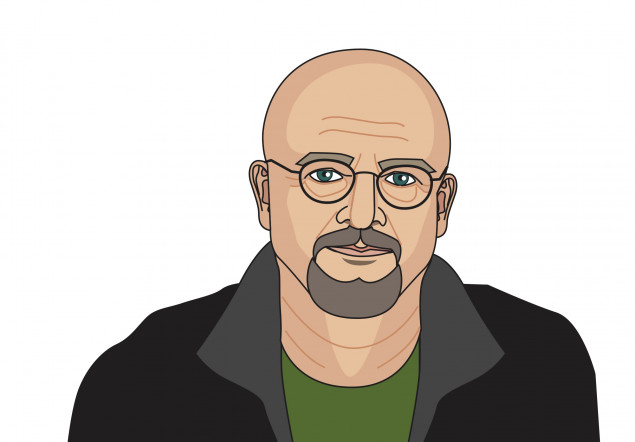
Kommentare